
Lied der blauen Frösche: Leseprobe: »Die Reise«
Ich tanzte auf der Bühne in Berlin am Theater. Der Saal war voll besetzt und das Publikum freundlich. Ich aber hatte höllische Schmerzen im Knie, fürchtete jederzeit hinzufallen. Ich sah das Publikum mich bereits auspfeifen, und eine Mischung aus Scham, Blamage und Schmerz, ja vor allem Hoffnungslosigkeit schien mich fast zu erdrücken, während ich lächelnd meine Rolle zu tanzen versuchte. Anders als gewohnt musste ich dieses Mal beim Tanzen auch noch einen schweren Koffer und einige andere Gepäckstücke während der Aufführung mit mir herumwirbeln. Plötzlich wurden meine Glieder gummiartig weich, ich schien mich langsam aufzulösen, und die freundlichen Gesichter des Publikums verwandelten sich in große starre Masken, mit grimmigem Gesichtsausdruck, manche hämisch grinsend. »Aus«, dachte ich. »Sie werden mich nie wieder auf eine Bühne lassen, nie wieder werde ich die Bretter, die auch mir inzwischen ›die Welt‹ bedeuten, betreten dürfen.« Verzweifelt und mit letzter Kraft versuchte ich die Schmerzen zu ignorieren, und das lästige Gepäck lächelnd und tanzend zu bewältigen – da tat es einen ordentlichen Ruck –, ich fiel beinahe von meiner Bank, und so erwachte ich äußerst unsanft aus diesem schweren Albtraum.
Meine Glieder waren steif von der harten Holzbank, auf der ich die eiskalte Nacht zu verbringen versucht hatte. Ich war anscheinend endlich in den frühen Morgenstunden ein wenig eingeschlafen.
Instinktiv packte ich nun den großen Schrankkoffer, rannte in Panik zur Tür, schmiss ihn aus dem anfahrenden Zug, grabschte irgendwie mein restliches Gepäck zusammen, rannte wieder zur Türe, schmiss erst das Gepäck hinaus – und sprang dann selber hinterher. Es war gerade noch rechtzeitig, bevor es unmöglich geworden wäre abzuspringen.
Am Abend vorher war ich in Posen angekommen, auf der Reise Richtung Zempelburg, über Schneidemühl. Der Bahnhof Posen war fast leer, als ich am dritten Januar 1942 in der Dunkelheit dort ankam. Kaum eine Menschenseele war zu sehen, und mein Anschlusszug war längst weg. Ein freundlicher Schaffner riet mir, den Zug auf dem anderen Gleis zur Übernachtung zu nehmen, ich solle aber nicht vergessen, dass dieser am nächsten Morgen früh wieder eingesetzt werde.
Nun, ich hatte es Gott sei Dank geschafft, wenn auch auf etwas ungewöhnliche Weise ›rechtzeitig‹ herauszukommen.
Erleichtert sammelte ich mein ziemlich verstreut liegendes Gepäck auf und stellte alles neben mich, schaute dem entschwindenden Zug nach, dem ich gerade noch entkommen war, und überlegte, was nun zu tun sei. Zunächst hatte ich Hunger. Ein paar Scheiben Brot mit Margarine hatte ich noch im Gepäck, und davon wurde nun eine andächtig gekaut.
Man war das Warten ja inzwischen gewöhnt. Nach einigen Jahren des Lebens im Krieg war nichts mehr so, wie man es vorher gekannt hatte, und täglich änderten sich die Dinge. Man wurde sehr flexibel und war froh, wenn man heil von einem Ort zum anderen kam.
Immerhin hatte ich es von Augsburg über München, Berlin ,Frankfurt/Oder bis hierher ja schon auf ganz passable Weise geschafft, trotz der inzwischen fast überall üblichen Luftangriffe der Engländer.
Meine Patentante Trude, Muttis Schwester, war kurz vor Weihnachten an Krebs gestorben. Ich hatte sie erst wenige Wochen vorher persönlich kennen gelernt, als sie auf der Durchreise bei uns in Augsburg zu Gast war. Sie war auf dem Weg zu einer Klinik in Südbayern, die Strahlentherapie für Krebskranke anbot. Ich saß an ihrem Bett, in dem sie sich, von der Reise sehr geschwächt, zu erholen versuchte.
Mein Engagement in Berlin am Theater hatte ich schweren Herzens unterbrechen müssen, da eines meiner Knie stark entzündet war. Es musste für eine Weile ruhig gestellt werden, zumindest war das Tanzen auf der Bühne vorübergehend unmöglich geworden.
Tante Trude und ich, wir lernten uns also unter recht unerfreulichen Bedingungen kennen, aber wir waren uns schnell sehr sympathisch.
»Gitti«, sagte sie, als ich sie am Nachmittag wieder an ihrem Bett besuchte, »ich weiß, dass ich dieses Jahr nicht überleben werde. Nein, nein, es hat keinen Sinn, die Situation schönzureden, ich fühle es ganz deutlich. Aber ich hätte eine große Bitte an dich: Da du ja nun auch Schonzeit hast – könntest du nicht nach Niecharz reisen, wenn ich nicht mehr bin, und dem Onkel Emil etwas zur Seite stehen, vor allem auch wegen der beiden Kinder, die ja dann ohne Mutter sein werden. Es wäre mir eine große Erleichterung zu wissen, dass du die ersten Wochen bei ihnen sein wirst. Es würde mir das Sterben wirklich sehr erleichtern.«
Ich hatte diese tapfere Tante in den wenigen Stunden bereits sehr ins Herz geschlossen, und natürlich versprach ich ihr, zu Onkel, Vetter und Cousine zu reisen, um ihnen ein wenig zur Hand zu gehen, in den schwersten Stunden zu Anfang, falls die Tante denn wirklich Recht behalten sollte mit ihrer Prognose.
Und nun stand ich also hier in Posen und wartete auf die nächste Gelegenheit zur Weiterreise. Wenn man so seinen Gedanken nachhängt, das kürzlich Vergangene betrachtet und sich das Kommende vorzustellen versucht, vergeht die Zeit ziemlich schnell. So konnte ich denn bald in den Zug nach Schneidemühl steigen. Viele Leute waren jetzt unterwegs, alle mit einer Menge Gepäck. Man machte es sich im Zug so bequem wie irgend möglich. Ich hatte sogar einen Eckplatz gefunden und versuchte mich ein wenig einzukuscheln, denn die Müdigkeit begann überhand zu nehmen, kaum dass ich ein paar Minuten saß. Ich war nun schon den zweiten Tag unterwegs und hatte ja die Nacht vorher auf dem Abstellgleis in dem kalten Waggon auch kaum geschlafen.
Der Zug ratterte so dahin, ab und zu blinzelte ich in die verschneite Landschaft, die aber keinerlei atemberaubende Anblicke zu bieten hatte.
Einige der Mitreisenden unterhielten sich, teils in Polnisch, teils in Deutsch, und das Gemurmel und die relative Wärme im Abteil ließen mich gleich wieder eindösen.
Zwischendurch aß ich wieder ein bisschen Brot, trank aus der Flasche etwas mitgebrachten kalten »Muckefuck« und gab mich wieder meinen Gedanken hin.
In Schneidemühl musste ich aussteigen und den Bummelzug nach Zempelburg nehmen, denn nur dieser hielt in »Sepolno-Tal«, wo mich der Onkel abholen würde.
Es war inzwischen schon wieder fast ein Tag vergangen, als ich in jenem Bummelzug saß, mit dem ich nun endlich ans Ziel gelangen sollte. Es schneite unaufhörlich. Wieder saß ich auf einer harten Holzbank in einem kaum geheizten Zug. Außer mir waren nur noch ganz wenige Leute im Waggon. Jeder schien so seinen Gedanken nachzuhängen. Gespräche hörte ich keine. Ich malte mir aus, wie schön es sein wird, wenn nun gleich der Onkel, den ich auch noch nicht kannte, mit dem Pferdeschlitten am Bahnhof auf mich wartet und wir in warme Fußsäcke gehüllt die letzten Kilometer bis zum Hof zurücklegen werden; stellte mir vor, wie wir am warmen Ofen sitzend zusammen Abendbrot essen, uns bekannt machen, und ich freute mich vor allem auf ein schönes warmes Bett!
Es wurde bereits wieder dunkel, als das Züglein, nicht mehr als vier Waggons, sich wacker durch den Schnee arbeitete. Laut Plan, und der Zug war beinahe pünktlich, sollte ich in zehn Minuten in »Sepolno-Tal« ankommen. Ich begann etwas nervös zu werden, packte meine Sachen zusammen und versuchte mir wieder und wieder die Ankunft am Bahnhof und später auf dem Hof vorzustellen. Die Haltestellen schienen jeweils nur aus einem sehr kleinen Häuschen zu bestehen, sonst konnte ich nichts erkennen beim An- und Abfahren an den Stationen.
Endlich, endlich war es so weit. Das Züglein hielt auch hier an einem kleinen Häuschen, der Schaffner rief: »Sepolno-Tal«, ich stieg aus, die Lokomotive mit den vier Waggons nebst Schaffner fuhr wieder an und entschwand in der Ferne.
Ich war also ausgestiegen und stand nun überraschend allein auf weiter Flur, mit meinem riesigen Schrankkoffer, einem Rucksack, einer Umhängetasche und einer mittelgroßen Tragetasche.
Es war inzwischen stockdunkel, schneite immer noch ununterbrochen, das Bahnhofshäuschen war offensichtlich leer und unbewohnt, und weit und breit war kein Onkel oder irgendein anderer Mensch zu sehen!
Es befanden sich auch sonst keine Häuser in der Nähe. In weiter Ferne erspähte ich dann aber doch ein Licht, nachdem meine Augen sich etwas an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Was blieb mir anderes übrig, als mich und mein Gepäck in diese Richtung zu bewegen, bei immer stärker werdendem Schneetreiben, und durch wadenhohen Schnee.
Nun begann sich doch allmählich echte Verzweiflung in mir auszubreiten, aber ich musste ja weiter, irgendwie zum Hof meines Onkels kommen, oder besser noch, endlich eine Bleibe zum Übernachten finden.
Ich war inzwischen wirklich erschöpft. Am Haus, in dem das Licht brannte, angekommen, klopfte ich an die Türe. Es dauerte sehr lange, bis eine ängstliche, beinahe verschreckte weibliche Stimme rief: »Wer ist da?« Jedenfalls vermute ich, dass es das hieß, denn es war Polnisch und das verstand ich damals noch überhaupt nicht. Jedenfalls antwortete ich auf Deutsch: »Ich will zu Rathkes, nach Niecharz. Ich kam mit dem Zug und bin nun ganz allein und fremd hier. Kann ich vielleicht bei Ihnen übernachten?«
Inzwischen war die Frau zur Türe gekommen, öffnete diese einen kleinen Spalt und hob abwehrend und beinahe erschrocken die Hände, als ich um Übernachtung bat. »Kann ich dann bitte wenigstens diesen großen Koffer bei Ihnen lassen?«, fragte ich daraufhin schüchtern. Ja, das konnte sie mir gewähren, und so öffnete sie die Türe ein wenig weiter, sodass ich diesen großen Koffer in den Flur schieben konnte. Es war doch schon eine sehr große Erleichterung, nun nicht mehr dieses Ungetüm mitschleppen zu müssen. Sie sagte noch, diesmal tatsächlich in Deutsch: »Sie müssen nur die Bäume entlang gehen, dann kommen Sie irgendwann nach Niecharz.«
Ich bedankte mich und hatte nun immerhin eine Richtung, der ich folgen konnte.
So ging, besser schleppte ich mich also mit dem restlichen Gepäck diese Allee entlang. Irgendwann drückte die Blase so sehr, dass ich mich erleichtern musste. Dabei fiel ich dann prompt hinterrücks in den Schnee. Es war aber auch zu dunkel, man sah so gut wie nichts, fühlte nur dieses unheimlich starke Schneetreiben, das zu versuchen schien, alles, was sich draußen befand, völlig zu bedecken, und den jeweils nächsten Baum konnte man auch nur immer wieder erahnen.
Irgendwo aus der Ferne drang ein schauriges Heulen zu mir herüber. »Nun kommen auch noch Wölfe«, dachte ich, »ist mir aber jetzt auch schon alles egal.« Ich hatte nicht einmal mehr Angst, dazu war ich bereits viel zu müde, resigniert oder bereits total abgestumpft. So stapfte ich denn nur noch mechanisch weiter und weiter, als ich plötzlich einen Lichtschein wahrnahm. Der Schein wackelte unruhig hin und her, kam näher, und ich erkannte jemanden auf einem Fahrrad.
Ich rief: »Hilfe, Hilfe«, aber das Rad fuhr weiter. Noch einmal rief ich lauter: »Hilfe, Hilfe!« Da hielt das Fahrrad an, und als ich es erreicht hatte, sah ich, dass ich eine Frau vor mir hatte. Ich erklärte ihr meine Situation, erläuterte ihr, wo ich hinwollte, und es stellte sich heraus, dass sie nicht nur gut Deutsch sprach, sondern sie wusste auch, dass ›die Frau‹ gestorben war. Ja, das sei meine Tante, erklärte ich ihr, und ich fragte sie, ob ich nicht mein Gepäck auf ihr Rad laden könne. Ja, das könne ich gerne, erwiderte sie, und so ging sie neben mir her und schob ihr Fahrrad mit meinem Gepäck. Wie dankbar war ich wieder für diese Hilfe!! Nach einer ganzen Weile des schweigenden Nebeneinanderhergehens deutete diese Frau zur anderen Straßenseite: »So, das sind Rathkes hier links. Aber lassen Sie mich erst weggehen, die haben nämlich zwei ziemlich wilde Hunde dort, vor denen habe ich Angst.«
Ich bedankte mich herzlich für die Hilfe, und sie entschwand.
So stand ich nun wieder allein. Vor mir eine Mauer mit zwei Toren, einem großen für Gespanne und einem kleineren für Fußgänger. Ich öffnete das kleinere Tor, und kaum war ich eingetreten, hatte ich auch schon vier Hundepfoten auf meiner Schulter, zwei von vorne und zwei von hinten.
Beruhigend sprach ich auf die Tiere ein, »Ist ja gut, mein Kleiner, ist ja guuuht« - und tatsächlich ließen die Hunde nach kurzer Zeit von mir ab. Zu meiner eigenen Überraschung war ich plötzlich auch selber innerlich völlig ruhig und entspannt. Ich tastete mich um das dunkle unbeleuchtete Haus herum, fand eine breite Treppe, die zu einer Türe führte, und dort klopfte ich. Nichts rührte sich. Ich klopfte noch einmal, wieder blieb alles still. Dann ging ich wieder um das Haus herum und begann an verschiedene Fenster zu klopfen. Endlich ging in einem der Zimmer ein Licht an. Es muss inzwischen so um Mitternacht gewesen sein.
Nachdem im Hause Licht zu sehen war, stapfte ich wieder zur Eingangstüre zurück. Ein Mann mit Zipfelmütze auf dem Kopf öffnete mir die Türe. So erschöpft ich auch war, dieser Anblick erheiterte mich für einen Moment.
»Wer sind Sie, was wollen Sie?«, fragte er sehr ungehalten.
»Ich bin die Gitti, und ich sollte hier ein bisschen zur Hand gehen.«
»Aber doch erst morgen«, antwortete er.
»Nein, heute«, beharrte ich, »habt ihr denn unser Telegramm nicht bekommen?«
»Doch schon, aber ich dachte, deine Ankunft sollte erst morgen sein.«
Wie dem auch sei, nun war ich da und wurde auch eingelassen.
Ohne sich nach meinem Befinden oder nach dem Verlauf der Reise zu erkundigen, zeigte mir der Onkel mein Zimmer und das Bett.
Das Zimmer lag vor dem des Onkels, es war ungeheizt und wohl auch unbeheizbar, nur das Zimmer des Onkels hatte einen Kachelofen, wie ich durch die offene Türe erkennen konnte.
Aber ich war so unendlich müde, dass mich weder das eiskalte Zimmer noch das ebenso kalte Bett wirklich noch schockieren konnte. Kaum, dass der Onkel in seinem Zimmer verschwunden war, konnte ich nur noch das Wesentliche entkleiden und ungewaschen ins Bett sinken. Mir war so ziemlich alles egal, wenn ich mich nur endlich lang strecken konnte, mich in die Kissen schmiegen und schlafen – nichts als schlafen wollte ich.
Traumlos verging der Rest der Nacht.
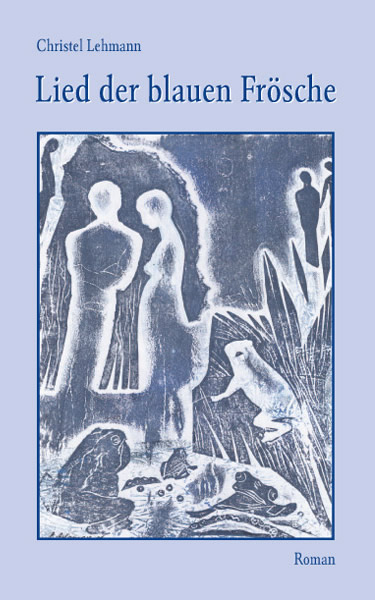
Buchumschlag: »Lied der blauen Frösche«